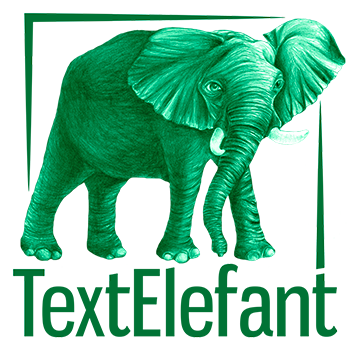Texte
Hier können Sie sich einen Eindruck von einigen meiner Texte verschaffen.
Die verlassenen Alten Siebenbürgens
Vor mehr als zehn Jahren fuhr ich mit frischem Mut und leichtem Sinn zum ersten Mal nach Siebenbürgen. Ohne Kenntnis von diesem Land und frei von Erwartungen, gespannt auf ein neuerliches Abenteuer namens Osteuropa. Dass (nicht nur) ich mich Hals über Kopf in dieses Land verlieben würde, konnte ich zuvor natürlich nicht ahnen. Und doch: Schon nach kurzer Zeit erwuchs ein Gefühl für dieses Land; ein Gefühl, das mir mein ganzes Leben zuvor fremd gewesen war. Ich fühlte Heimat.
Was es allerdings mit diesem Siebenbürgen oder mit diesem Rumänien auf sich hatte, das war und ist der westdeutschen allgemeinen Bildung ebenso fern und fremd wie ein Krieg in Ruanda oder Kinderarbeit in Bangladesch. Zumindest hatte man eventuell schon mal gehört, dass es so etwas gibt. Natürlich gierten wir nach Information, sprachen mit den Menschen dort und holten uns anderweitig weiteres Wissen. Und immer klarer wurde, was uns Medien verstohlen schon immer suggerierten: Die Länder Osteuropas, die jahrzehntelang unter der Knute des Sozialismus litten, und insbesondere dieses Land, sind fertig, am Boden, nicht mehr zu retten. Da kranken Wirtschaft, Infrastruktur, Demographie. Wer weg gehen kann, geht weg. Schließlich haben es schon diejenigen vorgemacht, die von der bundesdeutschen Regierung aus dem rumänischen Joch freigekauft wurden und im Austausch den Devisenhandel florieren ließen. Ihnen allen hat der Westwind die Lügen von schnellen Autos und Kindergeld ins Ohr geflüstert. Und dann, nach dem Zerfall des Ostblocks, nachdem endlich der teuflische Leuteschinder einem gerechtfertigten Tyrannenmord zum Opfer fiel, nach all den überstandenen Diktaturen – wie viele waren es eigentlich? – und Repressalien, in dem Augenblick, in dem man endlich wieder Luft schöpfen kann, anfangen kann, selbstbestimmt sein Leben zu gestalten, gerade da verlassen auch noch die meisten der übrig gebliebenen ihr Land. Sie verlassen ihre Heimat, ihre Tradition, ihr Erbe und geben ihr Leben auf, das ihre Ahnen sich immer wieder erstreiten mussten, das sie über 800 Jahre für wert befanden, es gegen fremde Herrschaft zu verteidigen. Im Tausch dürfen sie im goldenen Westen in zentralgeheizten Wohnungen mit fließendem Wasser leben, für ihre Lebensmittel viel Geld bezahlen, eine Hand voll Asche auf Sachsenfeste tragen und feststellen, dass nicht nur Gold glänzt. Viele gehen, nur ganz wenige kommen zurück und verfluchen den verdammten Lügner, der den Menschen als erstes den blendend-goldenen Märchensand in die Augen gestreut hat.
Warum also will ich nun dorthin gehen, von wo jeder weggeht, der es vermag – immer noch. Warum träume ich von einem Leben, das den meisten Menschen unsäglich unlebbar vorkommt oder sogar ein alltäglich gelebter Albtraum ist? Warum will ich Teil werden von einer Demographie, deren Lebenskraft mit Stumpf und Stiel ausgerissen wurde, von der nur mehr ein paar schwache Äste übrig sind? Denn dies scheint der Fall zu sein: Nur die Alten sind geblieben, und wer jung und immer noch dort ist, der hat in seinem Leben wohl einiges falsch gemacht.
Ich will nicht dorthin gehen, um mich einer vermeintlich dorthin gehörenden Tradition zu verhaften, mich als Siebenbürger Sächsin oder Neu-Sächsin zu fühlen. Die Zeiten hierfür sind vorbei, daran ändern auch sächsische Trachtenfeste nichts. Was ich will, ist ein einfaches Leben, in dem ich möglichst unabhängig bin von fremder Herrschaft, industrieller Produktion und Kapitalismus und selbst für Wohl und Wehe Verantwortung trage. Gerade so, wie die Menschen es in Siebenbürgen seit Jahrhunderten gelebt haben. Und gerade so, wie die letzten Alten, sofern es ihre Kräfte zulassen, immer noch leben. Wo aber haben diese Alten einen kulturellen Rückhalt? Womit identifizieren sie sich? Können sie sich immer noch als Siebenbürger Sachsen fühlen? Diese Frage kann wohl nur beantwortet werden, wenn man sie den Menschen dort stellt.
Will ich dann, später, auch eine von diesen Alten werden? Was ist, wenn meine Kinder auch dem bäuerischen Leben den Rücken kehren, von dort in die Stadt oder in ein anderes Land gehen und mich dort zurücklassen? Auch sie wollen und werden früher oder später ihr eigenes Leben, ihre eigenen Familien haben, wo ich dann vielleicht nur störe und zur Last falle. Wie werde ich mich dann entscheiden? Ich weiß es nicht.
Verfasst für ein Kolloquium des Roland Girtler, Wiener Professor für Soziologie
Köln-Süd, linksrheinisch
Nachts alleine auf der Mole sitzen und dem Mond beim Abnehmen zusehen kann wohl kaum Tätigkeit sein? Ein wenig Einbildungskraft genügt schon mir vorzustellen, es sei eine Nacht an der Schlei und der Wasserarm führt mich direkt zum Meer. Doch nein, zu wenig Segelboote und das Dröhnen der Schiffsdiesel zerteilt die Nacht viel zu langsam in Abfolgen von Backbord- und Steuerbordlampen, die ihnen unbekannte Bugwellen verspätet an die Steine wogen lassen. Unter den Steinen klingt es wie Metall auf Metall, wenn das Wasser sich hebt und senkt, vielleicht eine norwegische Fischbüchse, die dem holländischen Kapitän in Frankreich über Bord ging und sich in den Kölner Steinen verfing? Müßig, der Sache auf den Grund zu gehen.
Am anderen Ufer der leichte Widerschein zweier Feuer, an denen vielleicht gesungen wird, vielleicht auch nicht. Hinter mir die Festbeleuchtung rheinischer Gastronomie, die auf all diejenigen wartet, die in Berlin, der Stadt des ganzjährigen Draußensitzens, bemäntelt das Ausharren nicht mehr sommerlauer Nächte hätten erlernen können.
Ein Zander erfährt sein Ende am nächtlichen Rheinangelhaken – Schmeckt wunderbar! - Ganz sauberes Wasser hier! - beteuert man mir.
Nachts allein am Rhein sitzen? Das sei für eine Frau doch eher untypisch, bekomme ich gesagt.
Datenschutz
Meine Tochter war ein gutes Jahr alt, als ihre Patentante zu Besuch kam. Man trank Kaffee im Garten, schnackte eine Weile und verfiel auf die Idee, sich blödsinnig zu verkleiden. Viel Gelächter: meine Tochter ausstaffiert mit Hut und riesiger Sonnenbrille. Fotos wurden geschossen.
Ein paar Tage später erwähnte eine Freundin, die Patentante habe die Fotos des Besuchs – und also auch die meiner Tochter – auf einer namhaften social media-Plattform gepostet. Ich war sprachlos und wütend von dem Gefühl, einem Sachverhalt ausgeliefert zu sein, in meinen Bedürfnissen übergangen worden zu sein und meine ureigensten Überzeugungen ignoriert zu wissen. Nach einem kurzen und heftigen Telefonat hat sie die Fotos wieder gelöscht.
Warum aber will ich nicht, dass Bilder meiner Tochter durch das Netz geistern und dort von jedem Menschen, der Zugang zum Internet hat, betrachtet werden können? Sie ist doch so entzückend! Und weil es eine Binsenweisheit ist, dass das Internet eine gewisse Unübersichtlichkeit in sich birgt, stellt sich mir die Frage: Wer schaut sich diese Bilder an? Vielleicht ist es ja sogar ein Perverser, der sich – freilich ohne mein Wissen und ohne die Chance, dies je mitzukriegen – mit einem solch entzückenden Kinderbild Lust verschafft?
Früher, ich kenne es auch nur aus Berichten von Menschen, die ein paar Jahre älter sind als ich, hat man sich sogar geweigert, bei der Volkszählung die Türe zu öffnen und somit etwas von sich und seinem engsten Umfeld preiszugeben.
Heute dagegen scheint es für viele von uns völlig normal zu sein, bei jeder Gelegenheit kurz darüber zu berichten, was wir gerade tun oder wo wir uns befinden. Und immer dabei: Fotos und Filme. Eine unüberschaubare Bilderflut stürzt auf Bildschirme und Server ein. Die Tatsache, dass sie – einmal publiziert – unwiderruflich in den öffentlichen Raum gebannt sind, macht sie unkontrollierbar. All die neuartigen digitalen Errungenschaften, die uns das Leben erleichtern und uns miteinander verknüpfen sollen, sind nur für die wenigsten von uns durchschaubar. Wir wissen kaum, was mit unseren Daten passiert und wem sie zugänglich sind. Gesichtserkennung und Standortbestimmungen sind wohl erst der Anfang der medialen Datenkrake, die uns im Interesse von Konzernen und Institutionen oder von wem auch immer zu manipulieren sucht. Auch ein Mehrwert für die viel gepriesene Sicherheit ist nicht unmittelbar erkennbar.
Die einzige Möglichkeit, uns vor dem Missbrauch unserer Daten zu schützen, besteht darin, bewusst und kritisch mit ihrer Herausgabe zu verfahren.
Niemand kann verbal und medial inkontinenten Menschen verbieten, die Erfahrungen, Aktivitäten und Erlebnisse der eigenen Familie öffentlich darzustellen. Doch sollten wir uns darüber im Klaren sein, wo die Grenzen des Privaten zu ziehen sind. Ich selbst kann entscheiden, ob ich mein Konterfei in die unergründlichen Weiten des Äthers werfe. Doch Kinder sind in ihrer Unmündigkeit für sich selbst nur begrenzt verantwortlich. Die Verantwortung tragen wir. Und es geht niemand Fremdes etwas an, wer meine Kinder sind und wie sie aussehen. Sie können nicht darüber urteilen, ob Fotos oder Filme von ihnen auf fremden Bildschirmen in ihrem Sinne sind. Hier fängt echter Datenschutz an.
Ampelfrauchen
Die Ampel hat auf Rot geschaltet und das Ampelmännchen lacht mich nicht an. Das immergleiche Ampelmännchen. Ob das schon seit den fünfziger Jahren so aussieht? Oder sogar noch länger?
In Berlin findet sich das bunteste Biotop an Ampelschaffenden. Weibliche, wegen ihrer Zöpfe und ihres Rocks so zu nennen, und behoste oder behütete männliche. Lichttätige aus Ost und West, Seit’ an Seite traulich an Kreuzungen vereint. Ich bezweifle, dass die alle nach gleichem Tarif bezahlt werden. Und ob es irgendwo noch Beamte unter ihnen gibt? Die müssten dann schon sehr alt sein. Nach der Privatisierung des staatlichen Lichtzeichenamts sind die meisten bestimmt mit befristeten Niedriglohnverträgen angestellt. Und schon sind die Träume von einer gesicherten Rente dahin. Von einer gemütlichen Pension ganz zu schweigen. Es sollen sogar Ungelernte darunter sein. Die Arbeits- und Ruhezeiten wechseln in viel zu kurzen Abständen und besonders die stehend Tätigen arbeiten länger als sie ruhen. Aber dafür müssen sie ja auch nur rumstehen. Manchmal sehe ich an Kreuzungen auch Ampelfrauchen, doch diese so zu nennen, habe ich mich nur einmal getraut. Ein zorniger Blick versicherte mich der extremen Missbilligung für diese Bezeichnung. Hier hört der Spaß beim Gendern auf. Wie soll ich sonst sagen? Ampelmänninnen? Ein Hoch auf die Möglichkeiten, die Sprache so lange zu verbiegen, bis man sie ihrer Gefälligkeit und ihres Sinnes entleert hat.
Wir sollten es mal mit Ampeltierchen versuchen. Das ist so schön neutral. Und wir scheuen uns im sonstigen Leben bei Tierchen auch nicht, sie mit Dauerbelastung zu plagen. Ein grüner Wanderfalke im Schichtwechsel mit einer roten Seeanemone, Repräsentantin einer beinahe zur Bewegungsunfähigkeit verdammten Spezies. Im Augenblick des Schreibens überfallen mich Zweifel, ob irgendwer eine Seeanemone, besonders in der piktogrammatischen Vereinfachung, die ein Ampellicht erfordert, erkennen würde. Es muss einfacher gehen. Vielleicht so: Eine niedliche rote Katze, sitzend, den Schwanz adrett gelegt und vielleicht sogar – wie in der ‚gar traurigen Geschichte mit dem Feuerzeug‘ – warnend winkend, im Wechsel mit einer niedlichen grünen Katze, mit stolz erhobenem Schwanz erhaben schreitend. Niedliche Katzen ziehen immer.
Und dann begegnet mir die Fremde, und sie sagt mir: Du bist fremd!
Die Welt und ihre Landschaften, die Freiheit, die Romantik der Straße, fremde Länder und Kulturen, das Reisen überhaupt: Wie viel wurde und wird hierüber gedichtet und gesungen, erzählt, diskutiert, geschrieben und gelesen. Doch nicht nur die Fülle der so entstandenen Lieder, Texte und Bücher zeugt von der hohen Relevanz dieser Thematik. Diese wird auch deutlich durch die daraus resultierende Metaebene, die nicht nur wissenschaftlich durch beispielsweise Philologen, Ethnologen, Literatur- und Musikwissenschaftler repräsentiert wird, sondern auch im Alltag durch diverse soziale Gruppen, denen das Rezipieren von Reiseberichten zu einem Lebensideal verhelfen und so wieder neue Mobilität initiieren kann.
Über alle sozialen Grenzen hinweg gab es seit jeher immer wieder die Notwendigkeit zur Mobilität, und so verschiedenartig die mobilen Individuen oder Gruppen waren, so verschieden waren auch die Gründe zur Mobilität. Kann daher, ob einer stets neu aufkommenden Notwendigkeit zur Mobilität, das Reisen – unsere heutigen sogenannten Urlaubsreisen ausgenommen – als Akt freiwilligen menschlichen Handelns angesehen werden? Und können hier noch zwei dichotome Sichtweisen unterschieden werden insofern, als es möglich ist, dass die emische und die etische Perspektive divergieren in der Frage, ob eine spezifische Reise freiwillig oder erzwungen ist.
Hier sollen nicht die verschiedensten Arten und Motivationen von Mobilität im Einzelnen erörtert und analysiert werden. Stattdessen sollen einige theoretische Konzepte vorgestellt werden, die anhand von Beispielen den Terminus ‚Reisen‘ definieren sollen.
Es gebe keine freiwillige Migration, so hört man immer wieder diejenigen Menschen sagen, die sich um Belange von Migranten kümmern. Migration als Reise zu bezeichnen, ist selbstverständlich kritisch, erfüllt sie doch nicht die drei Kriterien, durch welche sich laut Fähnders eine Reise konstituiert: das Verlassen der Heimat, das Erreichen eines Zieles und die Rückkehr zum Heimatort. Die Nicht-Erfüllung der drei konstituierenden Faktoren einer Reise gilt für einige soziale Gruppen, deren Bewegung durch Raum und Zeit kein konkretes, absolutes Ziel kennt – und die in manchen Fällen wahrscheinlich auch keinen Ort haben, den sie Heimat nennen und an welchen sie zurückkehren können.
Was bedeutet es also, stets oder zumindest für eine lange Zeit auf Reisen zu sein? Es muss ein sensibles Wechselspiel von Anpassung an die Fremde und steter Verortung der eigenen Person sein. Die Fremde – ein Phänomen, das immer den Anruch des Suspekten konnotiert, gleichzeitig aber auch als Geheimnisträger eine Verführung darstellt. Was jedoch, wenn das Unterwegsein zur Heimat wird, wenn es keine Heimat, wenn es keinen Ort zum Bleiben mehr gibt?
Setzen wir einmal voraus, dass diese drei charakteristischen Elemente „Aufbruch – Ziel – Heimkehr“ eine Reise konstituieren oder sogar per definitionem notwendigerweise bedingen. Bedarf dann nicht der Terminus ‚Reise‘ einer genaueren Analyse? In seiner alltäglichen Verwendung besagt er eigentlich nur, dass man dann verreist, wenn man sich an einen Ort begibt, der nicht ‚zuhause‘ ist. Ob wir dort bestimmte Absichten hegen – und wenn ja, welche –, ist ein sekundärer Faktor, ebenso wie der temporäre Aspekt: Ob man drei Jahre oder nur einen Tag fort bleibt – man ist auf Reisen.
Das erste dieser drei Elemente ist noch vergleichsweise einfach: das Losgehen von daheim – sofern ein solcher Ort existiert. Gibt es einen Zielort, der angestrebt und erreicht wird und kehrt man danach zurück, so können wir von einer Reise sprechen. Einen Satz habe ich als reisende Handwerksgesellin irgendwann einmal im Laufe meiner Wanderschaft gelesen, der dieser Trias diametral entgegensteht: „Reisen heißt losgehen, ohne ankommen zu wollen.“ Was also machen all die Menschen, die zwar losgehen, die dabei jedoch kein konkretes Ziel vor Augen haben? Was ist mit den Handlungsreisenden, mit den reisenden Handwerkern, Wanderarbeitern, Wanderhirten – kurz: mit all jenen, die aufbrechen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und deren Route dabei lokal und temporär durch eine opportune Flexibilität determiniert wird. „Das Gras auf der anderen Seite des Hügels ist immer grüner“, dies behauptet zumindest ein Sprichwort. Es verdeutlicht, dass die Hoffnung auf das bessere Leben eine stete Motivation, eine stete Triebfeder, ein steter Motor für Mobilität sein kann.
Zu Zeiten, wo ‚Urlaub‘ noch ein Fremdwort war, war man unterwegs, weil man es entweder musste oder weil man es konnte. Ohne die uns vertraute und selbstverständlich genutzte Beförderungsmaschinerie war das Vagieren sozial unterprivilegierter Menschen sehr beschwerlich – was allerdings gleichfalls für die Reisen der wohlhabenden Elite gilt.
Die jungen Menschen der seit dem beginnenden 20. Jahrhundert entstandenen Jugendbewegung jedoch nahmen sich die beschwerliche, langsame und somit intensive Fortbewegung zum Vorbild und schufen sich eine neue Art von Mobilität: Sie wollten die Welt mit eigenen Augen sehen, sie begreifen, sie im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Dabei stellte das Reisen, oder das Fahren, wie sie es nannten, tatsächlich wie sprichwörtlich eine Befreiung aus den bestehenden engen, bürgerlichen Verhältnissen dar. Sie schufen sich selber eine Art des Reisens, das sich durch ein Charakteristikum auszeichnete: sie war frei von jeglicher Notwendigkeit und somit absolut freiwillig. Eines jedoch hatten die meisten ihrer Fahrten gemein, und dauerten sie noch so lange: Sie waren per se nicht dazu bestimmt, einen neuen Heimatort ausfindig zu machen, sie sollten den Fahrenden nicht so lange in der Fremde verweilen lassen, bis dieser ehemals fremde Ort schließlich so bekannt war, dass der Zustand eines Going Native erreicht war. Es war programmatisch und intendiert, zur persönlichen Entwicklung soziale Zugehörigkeit und Grenzen zu definieren und als temporärer Gast die eigene Anpassungsfähigkeit und Flexibilität zu schulen.
Ähnliches gilt für die jungen Menschen, die sich seit dem Mittelalter nach dem Abschluss ihrer handwerklichen Ausbildung auf die Walz begeben haben, um – wie man heutzutage so schön sagt – ihr Handwerk, andere Kulturen und nicht zuletzt sich selber kennenzulernen. Zunächst war diese Form des Reisens aus der Not geboren: Die hegemonialen Zünfte oktroyierten die lokalen Humanetats und gaben die gesamtgesellschaftlich relevanten Handwerksstrukturen und -regeln vor. Wollte ein Geselle Meister werden, so musste er sich auf Wanderschaft begeben, um in seinem Handwerk Erfahrung_ zu sammeln. Durch die Spuren, die er durch sein handwerkliches Schaffen hinterließ, konnte er selber Produzent kulturellen Erbes werden: sowohl von präsentablen Werken als auch von solchen, die nicht unbedingt ins Auge fallen. Doch noch ein weiterer Aspekt bewog die Zünfte, eine Wanderpflicht vorzugeben: Sie hegten die Hoffnung, dass die in die Fremde gesandten Gesellen sich in einer anderen als der Heimatstadt niederlassen und so nicht den heimischen Arbeitsmarkt belasten. Können wir hier, angesichts der damals bestehenden Wanderpflicht und der nicht unbedingt intendierten Rückkehr in die Heimat von einer Reise sprechen?
Die heutige Idee und Praxis des Gesellenwanderns unterscheidet sich von den historischen Faktoren in einigen Punkten gravierend. Immer noch sind sie auf der Straße und in Handwerksbetrieben präsent, auch wenn die Kultur des Gesellenwanderns natürlich längst nicht mehr so häufig vorkommt wie noch zu den Zeiten, als noch alle möglichen Dinge des täglichen Bedarfs wie Werkzeuge, Kleidung, Häuser, Lebensmittel und Gerätschaften handwerklich hergestellt wurden. Dabei sind es bei weitem nicht nur Zimmerer und Tischler oder andere Bauhandwerker, die in den charakteristischen Kleidern, ihrer ‚Kluft‘ durch die Lande reisen. Vielmehr ist es so, dass heute wie damals in fast jedem handwerklichen Beruf auf die Walz gegangen wird. Da schon seit langer Zeit keine Wanderpflicht mehr besteht, beruht die Walz heuer auf einer freiwilligen Entscheidung. So individuell wie die reisenden Gesellen sind auch ihre Intentionen und ihre Verwirklichung und Idee des Reisens. Das Spektrum reicht von solchen Menschen, die die Chance, die diese Reise ihnen bietet, begreifen und nutzen bis hin zu jenen, die sich auf eine reine Lustreise, wie Wadauer es nennt, begeben. Reisen bildet, sagt man. Ob man diesen Gewinn für sich selber daraus ziehen mag, liegt in der eigenen Verantwortung.
Wenn es vielen Menschen auch befremdlich scheint: Es gibt sie tatsächlich immer noch, die Menschen, die sich sogar im Zeitalter der DeGeneration facebook ganz reell auf Reisen begeben, um sich dem interessanten Wechselspiel von Fernweh und Heimweh hinzugeben. Und es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die es schaffen unterwegs zu sein, ohne sich durch das zwanghaft exhibitionistische Rudelphänomen Blog einer virtuellen Gesellschaft anzubiedern, oder solche, die sich auf das Fremde einlassen – und dabei der global verfügbaren medialen Welt trotzen, die, wenn nicht eine Heimat, wie Türcke es nennt, so durch die mittelbaren Bilder der Heimat doch eine Vertrautheit suggerieren kann.
Ist es nicht auch immer eine Sehnsucht, die uns treibt? Eine Sehnsucht, die nicht nur nach der Bewegung im Raum giert, sondern auch nach einer Bewegung in der Zeit, die wir durch den Besuch fremder Kulturen zu stillen versuchen: Jede Kultur befindet sich zu jeder Zeit in Entwicklungsprozessen, die demographische, technologische, künstlerische und soziale Komponenten einschließen. Diese Prozesse sind von sehr unterschiedlicher Qualität, und dennoch real und in verschieden großen Maße erkennbar – selbst wenn man Theorien vom sozialen und kulturellen Evolutionismus als obsolet erachtet.
Vielleicht ist es auch eine Sehnsucht zu uns selber, uns zu bereichern, uns zu wandeln: „Ich breche auf“, sagt man beim Losgehen. Wie soll dieses Aufbrechen verstanden werden? Ich breche auf – ist es das Selbst, das einen latenten oder sogar erkennbaren Bruch erfährt, sich öffnet? Bloch sagt, dass der Wunsch nach dem Neuen, folglich auch dem Fremden, erst die Notwendigkeit zur Veränderung generiert und die Möglichkeiten dazu entstehen lässt. Dies konnotiert, dass für den Erwerb des Fremden tatsächlich notwendigerweise ein Aufbruch vorausgesetzt wird.
Das Selbst-Erfahren der Welt setzt selbstverständlich zunächst den Willen voraus, ein Stück der Welt tatsächlich zu erleben und zu begreifen. Nicht nur der Ethnologe sieht diese Art der Konfrontation mit der Fremde als Berufung an. Zu den rein geographischen Wegen und Grenzen gesellt sich das Bewusstsein für die eigene Person in einer unbekannten Kultur und damit auch die eigenen Grenzen. Welcher Art und Intention auch immer die Bewegung über den Globus ist: Eine solche Bewegung ist kaum möglich ohne die Verortung der eigenen Person im jeweiligen kulturellen Kontext. Der Begriff des Selbst-Erfahrens kann hier also in jeder denkbaren Lesart verstanden werden.
Die Lieder und Texte, die sich mit dem Reisen in die Fremde befassen, sprechen oft von dem Verhältnis, das zwischen mir selber, gefangen und sozialisiert in einem spezifischen kulturellen Kontext, und der Fremde entstehen kann oder besteht. Kann und will ich dieses Ungewohnte verstehen? Es ist mühsam, denn das bedeutet möglicherweise auch, einen Teil von mir, von meiner Kultur in Frage stellen oder sogar aufgeben zu müssen. Fremdheit kann sich nur in einer Begegnung konstruieren. Jeder Ort, an welchem ich noch nie war, ist mir fremd. Wenn man von der enormen – nicht nur körperlichen – Distanz absieht, die sich durch die virtuelle Welt ergibt, könnte man sogar bewogen sein, den Aspekt der Befremdung auch medialen ‚Begegnungen‘ zuzuschreiben. Dass dies kaum möglich ist, begründet sich dadurch, dass es sich bei Begegnungen (nicht nur) in der Fremde notwendigerweise meist um ein ganzes Netz von Aktanten handelt. Notwendigerweise wird dann auch das Ich ein Teil von diesem Netz. Ich bin ich an solchen Orten die Fremde. Manchmal bleibt mein Fremdsein unbemerkt, manchmal ist es augenfällig. Besonders in letzterem Fall ist der Fremde selektiv sensibilisiert für meine Umwelt, zumeist jedoch für die Kategorisierung von Gleichheit und Unterschied. Da andere Kulturen mit gewissen Vorstellungen, wenn nicht gar Stereotypen, belegt sind, ist man auch kaum vor Erwartungen gefeit, wenn man sich auf Reisen begibt. Manchmal werden diese Erwartungen befriedigt, oft genug aber offenbart sich das genaue Gegenteil. Das kann der Fall sein bei ‚exotischen‘, fernen Reisezielen genauso wie beim Nachbardorf. Gerne suggeriert man die Erfüllung eigener positiver Erwartungen dadurch, dass man sich nur auf die vertrauten, scilicet angenehmen Komponenten einer Region einlässt. Ein globaler Gewinn stellt sich sicherlich dann ein, wenn die Begegnungen mit dem Fremden ein vielseitiges Wechselspiel kulturellen Gebens und Nehmens sind, wenn sie durch eine gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung bereichert werden.
Stets hat man die Freiheit zu entscheiden, ob man den Aufwand betreibt, sich auf das Fremde, auf die Fremde und auf Fremde einzulassen – oder es nicht zu tun. Sind diese beiden diametralen Entscheidungsmöglichkeiten ein denkbarer Faktor, nach dem man ‚Reisen‘ definieren kann? Diese Perspektive stellt eine Alternative zu dem definitorischen Trias nach Fähnders einerseits, zur Opposition zwischen Freiwilligkeit und Zwang andererseits dar. Selbstverständlich kann man sich nicht auf eine fremde Kultur so weit einlassen wie auf die eigene, ohne dass der oben erwähnte Zustand des Going Native eintritt. Vielmehr soll dieses Einlassen auf das Fremde signalisieren, dass man bereit ist, kulturelle Realitäten der Fremde als ebenso normal zu respektieren wie es vertraute Verhältnisse sind. Und hier schließt sich der Kreis, es wird sich wieder auf die zwei erwähnten Definitionen des Reisens zurückbezogen: Es ist einleuchtend, dass eher Menschen eine derartige Offenheit zutage tragen, die sowohl freiwillig unterwegs sind als auch einen Ort haben, an den sie wieder zurückkehren können.
Wenn wir also das Reisen nach dem Kriterium des Einlassens auf die Fremde definieren, können wir konstatieren: Auf eine wahre Reise begeben sich nur wenige Menschen.
Essay zum kulturwissenschaftlichen Kolloquium ‚Reisen als kulturelle Praxis‘ an der Universität Koblenz im Sommersemester 2012
Inspiriert von:
Bieri, P. 2002. Das Handwerk der Freiheit. München: Hanser.
Bloch, E. [1959] 1985. Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Fähnders, W. 2012. ‚Straße, endlose Straße‘ – Vagabundenliteratur und Vagabondage (1900-1933). Unveröffentlichter Vortrag zum Kulturwissenschaftlichen Kolloquium am 4. Juli 2012, Universität Koblenz.
Lévi-Strauss, C. [1955] 1978. Traurige Tropen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Türcke, C. 2006. Heimat. Eine Rehabilitierung. Springe: zu Klampen.
Wadauer, S. 2005. Die Tour der Gesellen: Mobilität und Biographie im Handwerk vom 18. Bis zum 20. Jahrhundert. Frankfurt/Main: Campus.